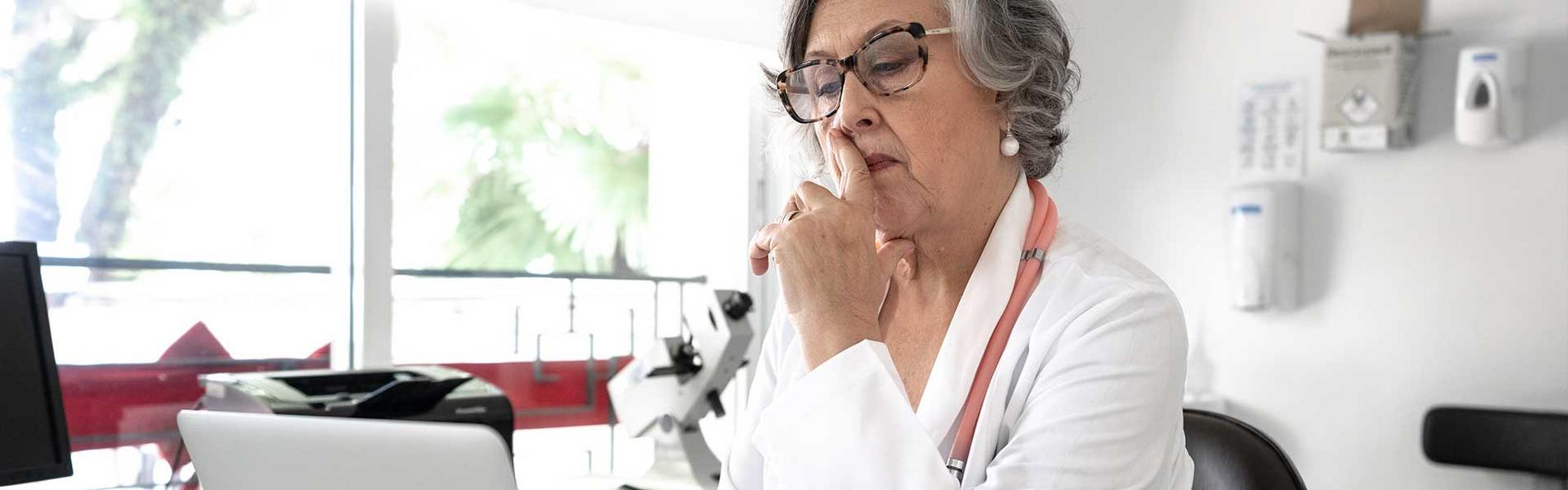
Alzheimer-Demenz: Die Krankheit besser verstehen
Fast jeder kennt solche Situationen: Man hat einen Namen auf der Zunge, aber er will einem einfach nicht einfallen. Der Schlüssel, den man nur kurz irgendwo abgelegt hatte, ist spurlos verschwunden, weil man nicht mehr weiß, wo dieses „irgendwo“ ist. Meist ist das harmlos, vor allem in stressigen Situationen. Doch wenn das Gedächtnis immer öfter streikt und auch Alltagssituationen zur Herausforderung werden, könnte mehr dahinterstecken. Zum Beispiel Alzheimer, die häufigste Firm der Demenzerkrankung. Die Krankheit beginnt schleichend, verändert das Leben von Betroffenen und Angehörigen aber grundlegend.
Was ist Alzheimer-Demenz?
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz und betrifft meist ältere Menschen ab 65 Jahren. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen nach und nach absterben. Dadurch kommt es zu einem Rückgang der Hirnmasse. In der Folge verschlechtern sich unter anderem das Gedächtnis, die Denkleistung und die Sprache. Auch die Persönlichkeit kann sich verändern, Betroffene können sich im Laufe der Erkrankung ungewohnt ängstlich, misstrauisch oder sogar aggressiv verhalten. Erste Anzeichen sind oft Vergesslichkeit oder Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Mit der Zeit können Betroffene alltägliche Aufgaben nicht mehr allein bewältigen. Alzheimer-Demenz ist derzeit nicht heilbar.
Was sind die Ursachen?
Die genauen Ursachen für eine Alzheimer-Demenz sind derzeit nicht geklärt. Sehr wahrscheinlich kommen mehrere Ursachen zusammen, die dafür sorgen, dass Nervenzellen im Gehirn absterben. So besitzen Menschen mit Alzheimer-Demenz zu wenig des wichtigen Botenstoffs Acetylcholin im Gehirn. Außerdem weiß man, dass sich im Gehirn von Betroffenen kleine Eiweißpartikel – als Plaques – ablagern. Möglicherweise sind sie für das Absterben der Nervenzellen verantwortlich. Genetische Faktoren spielen bei der Entstehung von Alzheimer eine untergeordnete Rolle. Sie liegen als alleinige Ursache nur bei weniger als zwei Prozent der Betroffenen vor. Selbst wenn bei Verwandten ersten Grades (Eltern, Kindern oder Geschwister) eine Demenz festgestellt wurde, geht man davon aus, dass dadurch das Risiko nur geringfügig erhöht ist, selbst daran zu erkranken.
Ab einem Alter von etwa 65 Jahren erhöht sich das Risiko für eine Alzheimer-Demenz. Es gibt Hinweise, dass bestimmte Risikofaktoren dazu beitragen – wie Diabetes mellitus und Depressionen, aber auch solche, die durch den Lebensstil beeinflusst werden können, wie ein erhöhter Cholesterinspiegel, Übergewicht, Bluthochdruck und Rauchen.
Symptome: Wie macht sich Alzheimer-Demenz bemerkbar?
Bei Betroffenen lässt zunächst das Kurzzeitgedächtnis immer mehr nach. Sie können sich Dinge schlechter merken und wirken vergesslicher. Später ist auch das Langzeitgedächtnis betroffen. Mit der Zeit nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab sowie die zeitliche und räumliche Orientierung.
Auch die Sprache wird beeinflusst. Menschen mit Alzheimer-Demenz haben Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden und bekommen die Bedeutung von Begriffen nicht mehr zusammen. Ihre Sätze wirken dadurch schwer verständlich, da sie fasche Begriffe oder Füllwörter benutzen, die eigentlich nicht in den Zusammenhang passen. Darüber hinaus können sie schwerer verstehen, was ihr Gesprächspartner sagt, oder sie können das Gesagte nicht begreifen.
Die zunehmende Verwirrung und der Verlust von Orientierung können bei Betroffenen zu einer Änderung der Persönlichkeit und des Verhaltens führen. Scham und Frust über den eigenen geistigen Abbau machen eventuell ängstlich, misstrauisch und passiv – oder auch aggressiv. Schlafstörungen und sogar Depressionen sind ebenfalls mögliche Begleiterscheinungen einer Demenz.
Wie verläuft eine Alzheimer-Demenz?
Nervenzellen sterben schon lange vorher ab, bevor die ersten Symptome auftreten. Diese können zu Beginn der Erkrankung noch unauffällig sein und den Alltag nicht beeinträchtigen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung werden die Anzeichen dann immer deutlicher. Ist im späteren Verlauf der Abbau stark fortgeschritten, können Betroffene ihren Alltag nicht mehr selbstständig bestreiten. Eine umfassende Unterstützung für alle Aufgaben des täglichen Lebens wird notwendig. Das stellt auch Angehörige vor große Belastungen. Dann kann der Umzug in eine Pflegeeinrichtung die beste Option sein, damit die Erkrankten die bestmögliche Pflege, Betreuung und medizinische Versorgung erhalten können. So schwer diese Entscheidung ist, es gibt immer mehr Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Alzheimer-Demenz zugeschnitten sind.
Wie wird Alzheimer-Demenz behandelt?
Im Kampf gegen Alzheimer-Demenz gibt es medikamentöse und nicht medikamentöse Therapien. Allerdings ist die Erkrankung bislang nicht heilbar. Die Behandlung zielt daher hauptsächlich darauf ab, den Alltag der Betroffenen zu verbessern, ihre Selbstständigkeit zu erhalten und schwierige Verhaltensweisen zu mildern. Dabei geht es nicht nur um den Kopf, sondern auch um Gefühle und soziale Kontakte. Auch die Angehörigen dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Denn eine gute Betreuung der Betroffenen kann auch die Angehörigen entlasten. So können sie aus der Rolle der Pflegenden heraustreten und wieder auf anderen Ebenen für ihre betroffenen Eltern, Partner etc. da sein.
Um Menschen mit Alzheimer-Demenz je nach Bedürfnissen, Krankheitsstadium und Lebenssituation optimal zu bereuen, kann ein ganzes Team von Fachkräften verschiedener Professionen (Medizin, Psychologie, Pflege und Sozialarbeit) notwendig sein.
Therapie ohne Medikamente
Die Art der Behandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem die bereits vorliegenden Beschwerden, wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist und letztlich auch die Persönlichkeit und Lebensgeschichte der Betroffenen. Die Maßnahmen sollen schließlich die Lebensqualität verbessern und nicht überfordern. Deshalb sollten die Therapien regelmäßig und individuell angepasst werden. Am besten begleitet durch geschultes Fachpersonal, damit die Übungen richtig durchgeführt werden. Genauso wichtig ist es, die Angehörigen mit einzubeziehen. Das gelingt zum Beispiel durch Pflegeberatung, Pflegekurse und spezielle Schulungen für Angehörige von Menschen mit Demenz. Dazu gibt es entsprechende Angebote von den Pflegekassen.
Medikamentöse Therapie
Die Medikamente, die in der Alzheimer-Behandlung eingesetzt werden, können die Alzheimer-Demenz weder heilen noch ihr Voranschreiten stoppen. Allerdings gibt es Wirkstoffe, die manche Symptome einer leichten bis mittelschweren Demenz kurzfristig lindern oder ihr Auftreten hinauszögern können. Dazu gehören Cholinesterasehemmer, Memantin und eventuell auch Präparate mit Extrakten des Ginkgo-Baums. Sie können helfen, das Gedächtnis und die Selbstständigkeit im Alltag länger zu erhalten.
Seit April 2025 ist ein neues Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab in der Europäischen Union zugelassen. Ziel der Behandlung ist es, den geistigen Abbau bei Menschen im frühen Krankheitsstadium zu verlangsamen.
Seit dem 1. September 2025 ist es für eine bestimmte Gruppe von Patientinnen und Patienten erhältlich. Lecanemab kommt für solche Menschen infrage,
- die sich im frühen Stadium der Erkrankung befinden und bislang nur geringe Einbußen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit haben,
- bei denen Eiweißablagerungen (Amyloid-Beta-Plaques) im Gehirn nachgewiesen sind, die typisch für die Alzheimer-Krankheit sind,
- die nur eine oder keine Kopie einer bestimmten Genvariante (ApoE4) aufweisen und
- die keine Gerinnungshemmer einnehmen.
Etwa 1 von 100 Menschen mit einer Alzheimer-Demenz erfüllt diese Anforderungen. Während der Therapie sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen notwendig, weil es zu Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und -blutungen kommen kann. Im Einzelfall muss medizinisch genau geprüft werden, ob die Behandlung überhaupt in Frage kommt, damit sichergestellt ist, dass sie mehr Vorteile als Nachteile bringt.
Kann man einer Alzheimer-Demenz vorbeugen?
Das lässt sich pauschal nicht beantworten, da die genauen Ursachen der Alzheimer-Demenz noch nicht hinreichend geklärt sind. Es gibt aber Hinweise darauf, dass bestimmte Verhaltensweisen bei der Prävention helfen können: Ansetzen sollte man an den lebensstilbedingten Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Rauchen. Ein Rauchstopp – oder gar nicht erst damit anzufangen – lohnt sich ohnehin in jeder Lebenssituation. Auch regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung können hilfreich sein. Darüber hinaus senken regelmäßige geistige Aktivität (Gedächtnistrainings, zum Beispiel das gute alte Kreuzworträtsel) und soziale Teilhabe das Demenzrisiko.
INTER Gesundheitsmanagement: Wir sind für Sie da!
Lebenssituationen können sich verändern. Mit der Privaten Krankenversicherung der INTER haben Sie einen leistungsstarken Partner an Ihrer Seite. So können Sie zum Beispiel durch unser Gesundheitsmanagement Unterstützung finden – für alle Berufsgruppen und Lebenslagen.
Quellen:
https://www.gesundheitsinformation.de/alzheimer-demenz.html
https://www.gesundheitsinformation.de/alzheimer-demenz-symptome-und-verlauf.html
https://www.gesundheitsinformation.de/lecanemab-leqembi-bei-frueher-alzheimer-demenz.html


Christiane Gagel ist die Expertin, wenn es darum geht, komplizierte Themen auch für den Laien verständlich zu machen. Sie verwandelt trockene Vertragsklauseln in praxisnahe Ratgeber. Ihr Motto: Nicht nur in Fragen der Gesundheit muss ein Thema verständlich und zugänglich erklärt werden. So unterstützt sie ihre Leser dabei, kluge Entscheidungen rund um die PKV, Vorsorge, Leistungen und Versicherungen im Allgemeinen zu treffen.
Weitere Artikel finden


